
Blog
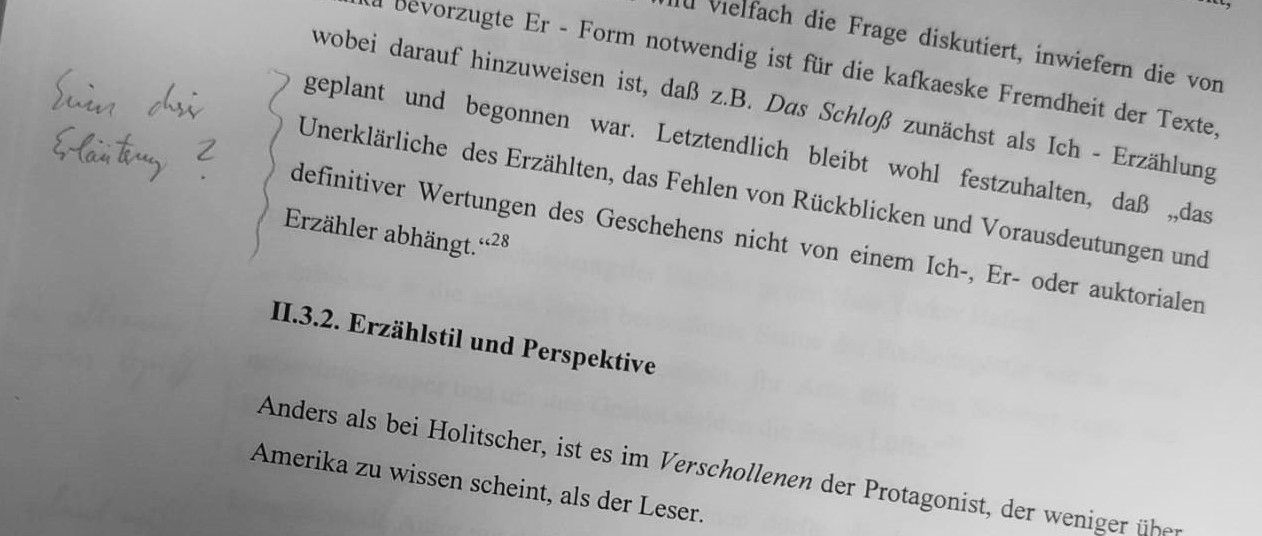
Es gibt kein anderes literarisches Werk, das ich, wie Kafkas, heute noch mit der gleichen Faszination lese wie vor Jahrzehnten schon als Schüler und dann als Student. Nur der Fokus hat sich oft verschoben. War es anfangs natürlich die Sensation des Kafkaesken, der Verfremdung und Verstörung, die mich fesselte, sind es heute ganz andere, eher unterschwellige Aspekte, etwa der Rhythmus der Sätze oder das Bühnenhafte des Szenenaufbaus.
In fast jedem meiner Bücher sind kleine Kafka-Referenzen versteckt, unscheinbare intertextuelle Verneigungen, die mir beim Schreiben das Gefühl geben, als leuchteten sie den schummrigen Weg vor mir ein wenig aus, und später, wenn sie mir dann auf Lesungen wiederbegegnen, als zwinkerten sie mir aus den Seiten kurz zu. Am deutlichsten sind die Bezüge in meinem letzten Roman Die Verteidigung. Er handelt von den Nürnberger Prozessen in den Nachkriegsjahren und der Rolle, die die Familie von Weizsäcker dabei gespielt hat. Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, ist damals eigentlich noch Jurastudent in Göttingen – und verteidigt nun vor Gericht seinen eigenen Vater, Ernst von Weizsäcker, der im Dritten Reich Spitzendiplomat und Staatssekretär war. In Nürnberg ist er wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Für dieses Kammerspiel über einen gesellschaftlich einschneidenden Prozess war Kafkas Prozess ein wichtiger Prätext. Aber auch zum Schloss sind etliche Spuren gelegt. Der Justizpalast etwa, in dem fast der gesamte Roman spielt, sollte ähnlich wie bei Kafka als eine Art lebendiger, das Geschehen undurchschaubar beeinflussender Organismus erscheinen. Als Reminiszenz an das Schloss wird er im Text immer nur Palast genannt. Die kafkatypischen topographierten Gedanken-Gänge durch seelische Katakomben wiederum klingen an einer etwas traumartigen Stelle an, in der sich die Hauptfigur Richard nachts im Justizpalast verläuft.
Durch die hohen runden Seitenfenster drang noch letztes Streulicht von benachbarten Trakten. Richards eilige Schritte hallten auf den Marmorplatten, die an einigen Stellen feucht glänzten, so dass er aufpassen musste, um nicht auszurutschen. Der Gang führte auf einen Querflügel und über dessen Schmalseite in eine weitere tunnelartige Flucht. Mit wachsender Beunruhigung und Neugier lief Richard sie entlang, trat dabei alle paar Meter aus dem Dunkel in hellere, von seitlich eingelassenen Schächten schwach beleuchtete Stellen und tauchte wieder ab, sein Blick fest auf einen raumhohen Lichtstreifen am Ende des Korridors geheftet, der, je näher er kam, von immer mehr sich überkreuzenden Linien verästelt war. Als Richard durch einen gemauerten Bogen hinaus in den Lichthof gelangte, erwies sich das Geflecht als weites Oval eines Stiegenhauses, dessen Brüstungen, Giebel und Balustraden die Halle auf etlichen Geschossen durchzogen. Die unüberschaubare Vielzahl an Verstrebungen, an auf- und absteigenden Rängen ließ das gewaltige Gewicht, das sie tragen mussten, ganz leicht erscheinen. Jeweils zwei Treppenarme wanden sich von der Mitte der Längsläufe zu den Ecken des nächsten Stockwerks. Die Geländer waren mit schmalen Doppelsäulen von der Halle abgegrenzt und von schmiedeeisernem Gitter durchrankt, Bronzebeschläge und vergoldete Zierkränze blitzten aus dem Gebälk, während vom Saum der Dachkuppel Zwickelfiguren ihre Ruten schwangen.
So aufmerksam Richard aber auch umherblickte, er konnte, was er sah, nicht zu einem klaren Eindruck bündeln, zu sehr griffen die vielen unterschiedlichen Konturen von Pfeilerreihen und Kreisbögen, von Gesimsen und Pilastern ineinander, woher kannte er überhaupt solche Begriffe. Richard kamen sie jetzt fadenscheinig vor, als umformten sie nur eine Leere, so wie das gesamte steinerne Gewinkel des Palastes, und er merkte, dass er ruhiger wurde, als er einfach weiterging, ohne genau auf alles zu achten. Er hatte sich von dem Palast bedrängt gefühlt, spürte aber nun, dass der überhaupt nichts von ihm wollte. (…)
Seine Schritte federten auf den Bodenplanken, die sich jetzt durch einen gruftähnlichen Gang zogen, flüchtig bloß bemerkte er Kabelleisten und Stützbalken mit Metallwinkeln unter der niedrigen Betondecke, Richard ließ eine Hand am feuchtkalten Gemäuer entlangfahren, es roch nach nassem Kalk, und er fragte sich, ob er überhaupt noch im eigentlichen Palast war oder schon tief unter der Erde in einem der Verbindungstunnel zum Gefängnis, konnte sich aber nicht erinnern, eine Treppe hinabgestiegen zu sein und seit Längerem an kein Geräusch außer seinem eigenen Gehen. Wo doch sonst fast zu jeder Tageszeit überall im Gebäude das gedämpfte Hämmern nie endender Reparaturarbeiten im Hintergrund pochte und die Gänge schwirrten vom unentwegten Öffnen und Schließen der Türen, den Stimmen dahinter, dem Telefonläuten, vernahm Richard nun allenfalls noch einzelne Tropflaute, das langsame Einsickern in eine Höhle.
Zu Beginn des Studiums habe ich meine erste Seminararbeit über Kafka geschrieben. An das Seminar, ein Blockseminar am Wochenende über Kafkas Quellen und ihre Einflüsse auf sein Werk, habe ich kaum eine Erinnerung – nur, dass ich die zwei Tage kein Wort gesprochen habe, mich nie meldete und mir die Stimmen der anderen und alle Geräusche im Raum manchmal so abgestumpft vorkamen, als säße ich tief versenkt in einem Holzfass und nur das rasende Pochen meines Herzens hallte dröhnend um mich herum. Wenn ich heute meine Hausarbeit von damals wieder lese, genau 25 Jahre später, muss ich unwillkürlich schmunzeln, halb peinlich, halb wohlsorgend berührt von der Plan- und Hilflosigkeit, die aus den Zeilen spricht, gegenüber Kafka, aber mehr vielleicht noch, nur spärlich kaschiert von bemühter akademischer Rhetorik, gegenüber dem Leben, das mich umgab, und der Suche nach einem passenden Platz darin. Ich war sehr unglücklich damals, das weiß ich noch. Aber auch, dass ich spürte, es könnte einmal wieder besser werden, so wie man ab einem bestimmten Kipppunkt in tiefer Nacht schon den nächsten Tag erahnt.
Mein Thema war Kafkas Roman Der Verschollene und die Spuren, die die Reisereportagen von Arthur Holitscher darin hinterlassen haben. Die Erlebnisberichte des ungarischen Schriftstellers fanden, recht zünftig geschrieben, um 1912 reißenden Absatz im deutschsprachigen Raum. Überhaupt interessierte mich, dass Kafkas so verrätselte Prosa auf häufig vergleichbar einfache, ja teils triviale Quellen aufbaute. Ähnlich waren sich Kafka und Holitscher dagegen in ihrer inneren Unruhe, der Unbehaustheit ihrer Identität, die das Schreiben antrieb. Beide haderten mit den Zwängen von Familie und Brotberuf – Holitscher arbeitete als Redakteur und Lektor –, beide rangen um einen Standpunkt zu ihrem Judentum, gingen zu politischen Vorträgen, suchten Orientierung und Veränderung. Doch während Holitscher oft umzog, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, und sofort die Gelegenheit ergriff, nach Amerika zu reisen, als sie sich bot, blieb Kafka in Prag und verschlang alles, was er über die ‚Neue Welt‘ in die Hände bekam. Als fänden sich irgendwo dort die Antworten auf seine Lebensfragen und er müsste sie nur nachlesen, nachschreiben, umschreiben, sich und seinem begonnenen Roman anverwandeln. Wie in einer offenen Versuchsanordnung spielte er existenzielle Probleme darin durch.
.jpg) Arthur Holitscher (vor 1926) – © CC 4.0
Arthur Holitscher (vor 1926) – © CC 4.0
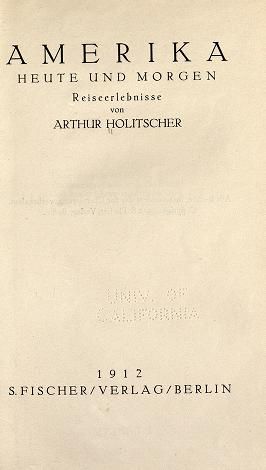 Umschlag der Erstausgabe Amerika heute und morgen – © CC 4.0
Umschlag der Erstausgabe Amerika heute und morgen – © CC 4.0
Die Anleihen, die er bei Holitschers amerikanischen Alltagsvignetten nimmt, geben seinem Verschollenen einen Authentizitätsanschein, den Kafka zugleich ästhetisch unterläuft und mit Fiktionssignalen bestreut, am augenfälligsten gleich bei der Ankunft Karl Roßmanns in New York, als ihn die Freiheitsstatue im Hafen nicht mit einer Fackel in der Hand empfängt, sondern mit einem Schwert. Und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. Statt in eine klassische amerikanische Aufstiegsgeschichte gerät Karl in eine langsam sich drehende Abwärtsspirale. Amerika ist nicht das erhoffte bessere Europa, schrieb ich in der Seminararbeit, sondern durch die äußerst reduzierte Perspektive Karls wie kindlich verklumpt, eine befremdliche Ungestalt, weniger Umwelt als Ausgeburt einer gequälten Seele. Entsprechend habe Kafka Holitschers Reisebericht äußerst selektiv gelesen und fast ausschließlich Stellen für seinen Roman herangezogen, die Amerika karikieren. Wo Holitscher vereinzelt durch Übertreibung das Typische verdeutlicht, macht Kafka die Ausnahme zum Normalfall, die Gesellschaft zur ausweglosen Hölle. Freiheitsstatue – © CC 4.0
Freiheitsstatue – © CC 4.0
Am Beispiel einiger Stellenvergleiche versuchte ich aufzuzeigen, wie Kafka die sozialistisch geprägte Kritik Holitschers an einer zunehmend technisierten, verdinglichten Arbeitswelt nicht wie dieser mit Blick auf den kapitalistischen Dämon und seine treibenden Kräfte aufnimmt, sondern ganz aus der Innensicht Karls heraus, eines einzelnen betroffenen Menschen, der das System nicht durchschaut. Nur erleiden kann er es. Und ist dabei – hierin dialektischer als der Prätext – auch selbst von Prestige- und Leistungsgebaren nicht frei. Zwar scheint Karl nach ersten Enttäuschungen endlich seinen Platz unter Gleichen zu finden, als er im Hotel Occidental als Liftjunge anheuert (das Vorbild bei Holitscher ist das Hotel Athenäum in Chautauqua, New York), doch schielt er seinerseits sofort auf eine Beförderung, um in natürlicher Folge eine höhere Arbeit zu übernehmen, wie unrettbar geprägt von jenem konkurrenzgetriebenen Erfolgsverständnis, das Holitscher und Kafka noch als typisch europäische Last verstanden, nicht unbedingt als amerikanische. Karl hat den sozialen Kampf verinnerlicht – und leidet zugleich darunter. Erst am Ende des Romanfragments deutet sich eine Überwindung und mögliche freie Entfaltung Karls an, im Naturtheater von Oklahoma, das ebenfalls Bezüge zu einer Stelle bei Holitscher aufweist, von Kafka aber ironisch wie zu einer biblischen Darstellung verfremdet ist: Die Menschenmasse, die Karl aufzunehmen verspricht, sitzt im Naturtheater nicht als passives Publikum auf den Rängen, sondern tummelt sich zu Hunderten als Engel verkleidet auf der Bühne.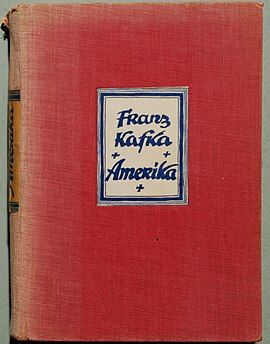 Umschlag der Erstausgabe von Franz Kafkas Amerika, 1927 – © CC 4.0
Umschlag der Erstausgabe von Franz Kafkas Amerika, 1927 – © CC 4.0
So zusammengefasst mag all das halbwegs plausibel klingen. Aber das täuscht. Die Seminararbeit schlingert durchweg – und sucht sich durch unnötig drastische Wertungen zu stabilisieren, wo es ihr an analytischem Halt fehlt. Wenn ich am Schluss schreibe, von Holitschers Amerikaberichten bleibe vor allem „ein gewisser Eindruck der Beliebigkeit, der Austauschbarkeit“ zurück, so schätzte ich damit ungewollt doch eher meine eigene Auseinandersetzung mit ihm und Kafka richtig ein. Wie ich überhaupt heute besonders jene Stellen der Arbeit sprechend finde, bei denen die teils rührenden Defizite so himmelschreiend sind, dass sie über die Textebene hinaus auf etwas Übergeordnetes zu verweisen scheinen. Einmal schreibe ich zum Beispiel, es sei sehr wahrscheinlich, dass Kafka eine versöhnliche Integration Karls im Naturtheater Oklahoma im Sinn hatte, bevor er die Arbeit am Roman abbrach; dass es mit Karl dagegen ein richtig böses Ende nehmen sollte, sei aber ebenfalls sehr wahrscheinlich. Ein anderes Mal beende ich einen Absatz zur Erzählhaltung brüsk mit der irgendwo abgeschriebenen Aussage, dass „das Unerklärliche des Erzählten, das Fehlen von Rückblicken und Vorausdeutungen und definitiver Wertungen des Geschehens nicht von einem Ich-, Er- oder auktorialen Erzähler abhängt“, was Martin Ottmers, der fürsorglich-geduldige Dozent des Seminars, dann in seiner Korrektur nur mit einem lakonischen „Sinn dieser Erläuterung?“ am Seitenrand kommentierte.
Es sind Belege des Lavierens, des Verlorenseins, das sich Karls Verschollengehen unfreiwiliig anverwandelte, so kommt es mir heute vor. Ihr passendes Gegenstück haben sie gleich zu Beginn der Arbeit, in der für mich merkwürdigsten Stelle: Ohne erkennbaren Zusammenhang habe ich dort ein langes Zitat von Hermann Hesse über Kafka in die Einleitung eingefügt. Hesse verwirft darin jedes erklärende Lesen Kafkas – und somit im Grunde auch mein eigenes akademisches Bemühen. Als wären es allein Kafkas Träume und Visionen seiner Nöte und Beglückungen gewesen, wie Hesse schreibt, der Trost des Verstandenwerdens und die flackernde Erhellung eines Auswegs, was ich damals in Wahrheit suchte, wie aus einem steinernen, von unüberschaubaren Verstrebungen an- und absteigender Ränge durchzogenen Gewinkel hinein in die eigene literarische Stimme.
Kafkas Erzählungen sind nicht Abhandlungen über religiöse, metaphysische oder moralische Probleme, sondern Dichtungen. Wer fähig ist, einen Dichter wirklich zu lesen, nämlich ohne Fragen, ohne intellektuelle oder moralische Resultate zu erwarten, in einfacher Bereitschaft, das aufzunehmen, was der Dichter gibt, dem geben diese Werke in ihrer Sprache jegliche Antwort, die er sich nur wünschen kann. Kafka hat uns weder als Theologe noch als Philosoph etwas zu sagen, sondern einzig als Dichter. Daß seine großartigen Dichtungen heute Mode geworden sind, daß sie von Menschen gelesen werden, die nicht begabt und nicht gewillt sind, Dichtungen aufzunehmen, daran ist er unschuldig. Er gibt uns die Träume und Visionen seines einsamen, schweren Lebens, Gleichnisse für seine Erlebnisse, seine Nöte und Beglückungen, und diese Träume und Visionen einzig sind es, die wir bei ihm zu suchen und von ihm anzunehmen haben.
Ich erinnere mich, dass ich mich plötzlich leichter fühlte, wie befreit, als ich die fertige Hausarbeit Herrn Ottmers ins Institutsfach legen ließ und zurück auf die Schellingstraße trat. Es tat gut, einfach nur durch das studentische Wimmeln zu laufen, ohne auf irgendetwas besonders zu achten. Um die Ecke kam ich am Alten Simpl vorbei, einst Anlaufpunkt jener schillernden künstlerischen Bohème, die Kafka vor hundert Jahren so angezogen hatte, und ein Stück weiter am Luitpoldblock, wo er im Kaffeehaus oft stundenlang Zeitschriften gelesen hatte, als er zum ersten Mal in München war. Ausgerechnet hier wollte er Germanistik studieren. Am Bayerischen Hof hätte mich dann beinahe ein vorbeipreschendes altmodisches Taxi gestreift. Seine dünnen Reifen ratterten wie ein Filmprojektor auf dem Straßenpflaster, und für eine Sekunde meinte ich, auf der Rückbank die flimmernden Schemen von Kafka und seinem Freund Max Brod zu erkennen, die auf ihrer Reise nach Italien eine halbstündige Blitzfahrt durch München einlegten, feixend mit einer jungen Frau zwischen sich. Vor der Galerie Goltz blieb ich kurz stehen und schaute zum ersten Stock hinauf. Dort hatte Kafka einst die Erzählung In der Strafkolonie vorgetragen, seine einzige öffentliche Lesung außerhalb Prags. Schattenhaft und bleich soll er da auf einer Rampe am Pult gesessen haben, eine Gestalt, schrieb ein Zeuge, die ihre Verlegenheit über die eigene Erscheinung nicht zu bannen wusste. Ein fader Blutgeruch habe sich im Raum ausgebreitet, als Kafka mit dünner Stimme und gelegentlichem hohen Auflachen die Marter einer langsamen Folter und Hinrichtung beschrieb. Eine Zuhörerin fiel in Ohnmacht, andere flohen. Am nächsten Tag musste Kafka in der Zeitung lesen, seine Geschichte sei stofflich abstoßend gewesen, er selbst als Vorleser ungenügend. Die künstlerischen Eindrücke waren wenig erquicklich. Nach München ist Kafka danach nie zurückgekehrt. Münchner Luitpoldblock mit Galerie Goltz – © CC 4.0
Münchner Luitpoldblock mit Galerie Goltz – © CC 4.0
Es hatte leicht zu regnen begonnen, als ich durch die Drückebergergasse zur Residenz kam, ich trat durch die schwere Tür des Museums, um mich kurz unterzustellen. Kein anderer Besucher schien sich hierher verirrt zu haben. Nur zwei Silhouetten, die hinter der Eingangstür lauerten, konnte ich nach einem Moment, in dem meine Augen sich an das Zwielicht gewöhnten, als Bedienstete erkennen, die mich wie erstarrt und mit weit aufgerissenen Eulenaugen durch die Dunkelheit des Flurs hindurch stumm ansahen und erschrocken die Köpfe schüttelten, als ich andeutete, ein Eintrittsgeld entrichten zu wollen. Mit langsamen Schritten, die bei jeder Stufe schwerer wurden, stieg ich die Treppe in das mittlere Geschoss hinauf, irgendwo weit entfernt heulte ein Tier.
Vielleicht lag es an der mangelnden Beleuchtung und der empfindlichen Kühle, dass die eigentlich prächtig verzierten Raumfluchten und Königsgemächer, das antike Mobiliar und die in Vitrinen ausgestellten Kronen, Porzellan- und Schmuckstücke auf mich unerwartet matt, ja wie von Moder und Sporen überzogen wirkten. Aus der stuckumrandeten Deckenaufhängung eines Kronleuchters rieselte fast unsichtbar feiner Putz auf die leise klingenden Kristalle, die schon wie von leichtem Schnee bedeckt waren, und über einer Chaiselongue verriet ein eingegilbter Abdruck an der Wand, dass hier lange Zeit ein Gemälde gehangen haben musste. An den verblichenen Druckstellen war die Wappentapete spröde gewellt und eingerissen. Etwas Beunruhigendes ging von diesem sich wie in einem langsamen Prozess fortschreitenden Verfalls befindlichen Ort aus, an dem nichts zu hören war außer dem nervösen Surren einer immer wieder flackernden Glühbirne. Mehrfach erschrak ich vor dem lauten Hall meiner eigenen Schritte auf dem Parkett.
Es lag bereits Abendtau auf dem glatten Schachbrettboden des Schwarzen Saals, als ich ihn, um diesen Räumen schnell wieder zu entkommen, bald Richtung Ausgang überquerte und dabei Schuhabdrücke hinterließ – da blieb mein Blick inmitten der flüchtenden Bewegung an ein paar Schwarzweißfotografien hängen, die zwischen den Fenstern zum Opernplatz offenbar als kleine Sonderexposition gruppiert waren. Sie zeigten Gebäude und Sehenswürdigkeiten des Hofviertels aus der unmittelbaren Umgebung. Den Pavillon in der Mitte des Hofgartens, die Feldherrnhalle, die Statue des sitzenden Königs auf dem Max-Joseph-Platz und dahinter die Arkaden der alten Post, alles lang vertraute, unzählige Male gesehene, aufgenommene und in die Welt verschickte Ansichten. Zugleich wirkten sie jedoch seltsam fremd und entrückt durch den weiten Winkel, den der Fotograf gewählt hatte, durch die starken Schwarzweiß-Kontraste und dadurch, wie ich erst nach längerem Hinsehen merkte, dass auf keiner der Fotografien auch nur ein einziger Mensch abgebildet war. Als sei eine fürchterliche Verheerung über die Bevölkerung gekommen, so leer, spurlos ausgestorben und dabei von schöner, unheimlicher Anmut beseelt wirkten diese verlassenen Stätten einstiger Lebendigkeit und menschlicher Errungenschaft.
Am längsten sah ich auf das letzte Bild, die Außenaufnahme jenes Königsbaus, in dem ich mich selbst in diesem Moment befand. Die an einigen Stellen schon lichten Pflastersteine des Vorplatzes fielen mir auf, die erleuchteten Laternen auf ihren wuchtigen Quadersockeln und die beiden erschlafften Fahnen auf dem verkürzten obersten Geschoss, das dem Gebäude das Gepräge einer gewaltigen Krone gab. Ich überlegte noch, woher das Licht durch den bedrohlich eindunkelnden Himmel fiel und die Fassade traf, dabei ihre feine, dichte Linienstruktur fast überscharf sichtbar werden ließ, die Bogen- und Arkadenfenster, die gemauerten Rahmenkränze, Vorsprünge und Dachbalustraden, woher kannte ich überhaupt solche Begriffe. Und schließlich meinte ich, während ich langsam immer näher mit dem Gesicht an das Bild heranrückte und die Augen zusammenkniff, um seine Einzelheiten noch genauer ausmachen zu können, in einem Fenster des rechten mittleren Traktes einen Schatten zu erkennen, die winzige Silhouette eines Mannes, der leicht vorgebeugt dazustehen schien, wie um etwas an der Wand zwischen den Fenstern zu betrachten, und neben ihm, erst im letzten Moment erkennbar, ein zweiter Schatten, der von hinten an ihn herantrat und mit etwas Länglichem, das wie ein Beil oder Hammer aussah, zum Schlag ausholte.
Fridolin Schley wurde 1976 in München geboren. Er studierte Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik an der Hochschule für Fernsehen und Film in München sowie Germanistik, Philosophie und Politik in München und Berlin. Er promovierte mit einer Dissertation über das Essaywerk von W. G. Sebald, die unter dem Titel Kataloge der Wahrheit 2012 erschien. Auf den Roman Verloren, mein Vater (2001) folgten weitere literarische und publizistische Veröffentlichungen, zuletzt der Roman Die Verteidigung (2021) über die Nürnberger Prozesse und die Rolle der Familie von Weizsäcker dabei. F. Schley lebt in München und leitet im dortigen Kulturreferat den Bereich Literatur und Preise.